- 29. Oktober 2025
- Posted by: Mario Kraatz
- Category: Zivilrecht
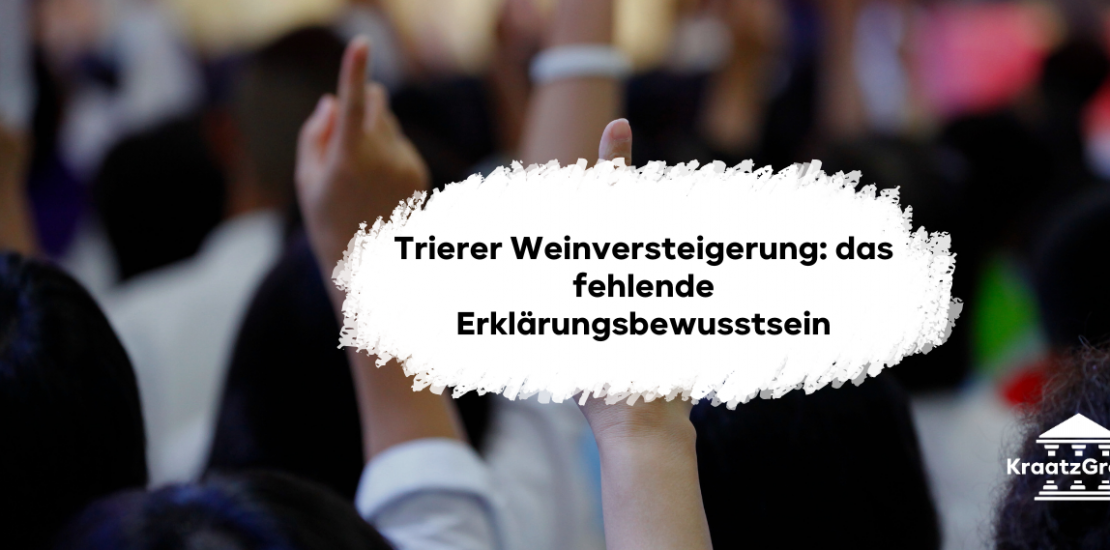
Jura Online lernen: Der Fallklassiker Trierer Weinversteigerung
Die Trierer Weinversteigerung ist ein echter Klassiker des BGB-AT und sollte daher auch in den ersten Semestern schon einmal aufgearbeitet werden. Der Fall „Die Trierer Weinversteigerung“ behandelt das Thema des fehlenden Erklärungsbewusstseins bei einer Willenserklärung. In abgewandelter Form findet der Fall daher bis in die heutige Zeit noch immer Einzug in juristische Prüfungen des Jurastudiums und Staatsexamens.
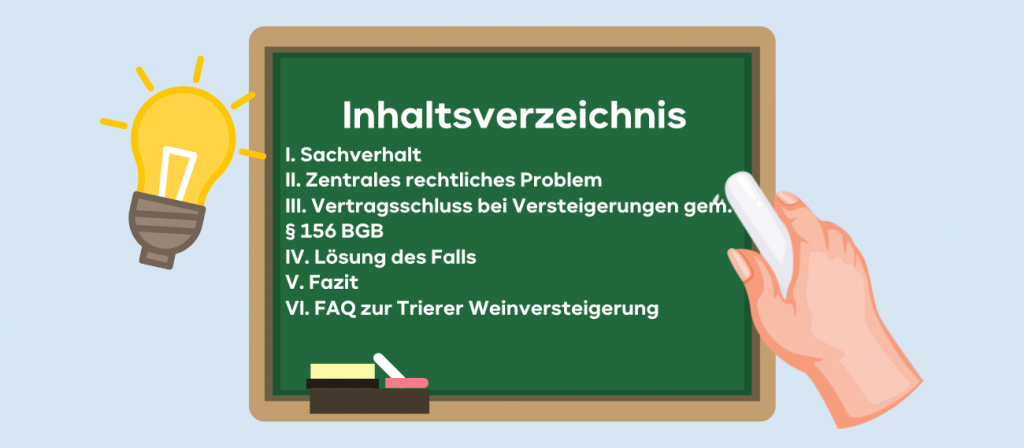
I. Der Sachverhalt der Trierer Weinversteigerung
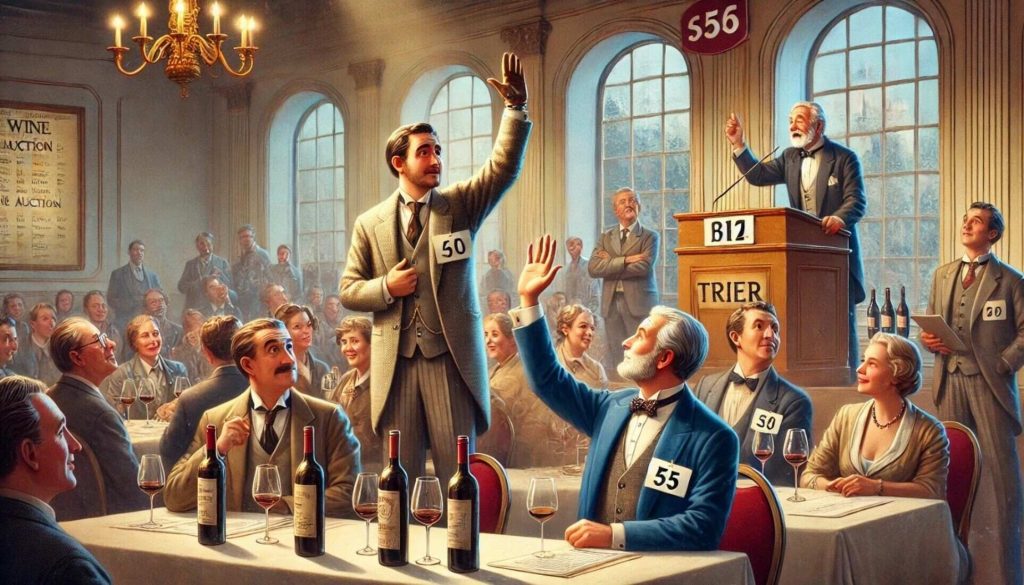
Der Sachverhalt dreht sich um eine Person (A), die bei einer Weinversteigerung in Trier ihrem Freund (F) zuwinkt, wobei der Auktionator (C), der seine eigenen Weine versteigert, dieses Winken als Gebot interpretiert.
Wie es kommen musste, wurde As Gebot nicht überboten, so dass A den Zuschlag für den Wein i.H.v. 500 EUR bekam.
C verlangt daraufhin von A die Abnahme und Bezahlung des Weines.
Hinweis: Der Fall wurde von Hermann Isay im Jahr 1899 in seinem Buch „Die Willenserklärung im Tatbestande des Rechtsgeschäfts“ eingeführt.
II. Zentrales rechtliches Problem des Falls
Das zentrale juristische Problem dieses Falls ist die Frage, welchen Einfluss das Fehlen des Erklärungsbewusstseins auf eine Willenserklärung hat. In diesem Kontext ist entscheidend, ob ein sogenanntes potenzielles Erklärungsbewusstsein ausreicht oder ob ein aktuelles Erklärungsbewusstsein notwendig ist.
Die Lösung des Falls erfolgt in einer detaillierten Analyse. Wie immer sollte die Behandlung der Problematik des Erklärungsbewusstseins nicht abstrakt und lehrbuchartig, sondern konkret anhand einer Falllösung erfolgen.
III. Vertragsschluss bei der Versteigerung gem. § 156 BGB
Bevor wir uns die gutachterliche Falllösung näher ansehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie der Vertragsschluss bei einer Auktion (Versteigerung gem. § 156 BGB) abläuft: Zunächst ist die Durchführung einer Versteigerung an sich eine bloße invitatio ad offerendum (= Aufforderung zur Abgabe eines Angebots). Das jeweilige Gebot eines Bieters ist ein Antrag, den der Auktionator annimmt. In diesem Kontext wird das Heben der Hand nach der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst.
Der Zuschlag ist übrigens eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung (Wortlaut des § 156 S. 1 BGB: „durch den Zuschlag“). Wenn der Bieter sich z.B. nach seinem Gebot entfernt und daher den Zuschlag nicht mitbekommt, ist dies unerheblich.
Weiterführender Hinweis: § 156 BGB regelt nur den schuldrechtlichen Vertrag. Die spätere Übereignung des Versteigerungsguts erfolgt nach den §§ 929 ff. BGB.
Exkurs: Versteigerung in der Praxis – Stellvertretung oder Kommissionsgeschäft
Der Versteigerer handelt im Normalfall als Vertreter (§ 164 Abs. 1 BGB) des Einlieferers des Versteigerungsguts. Mithin wird der Kaufvertrag gem. § 433 BGB zwischen dem Einlieferer und dem Ersteigerer geschlossen.
In der Praxis handelt der Versteigerer aber auch mitunter im eigenen Namen als Verkaufskommissionär des Einlieferers (§ 383 HGB). Mit einer derartigen Konstellation, die im Sachverhalt kenntlich gemacht wird, muss man zwar nicht im Grundstudium, aber im 1. Staatsexamen rechnen.
Du siehst, wie wichtig vernetztes Lernen ist. Hierauf legen wir auch im Rahmen unseres individuellen Jura Unterrichts und in unseren neuen Jura Skripten viel Wert – denn eins ist sicher: Der Schlüssel zum Prädikatsexamen in Jura ist nicht bloßes Auswendiglernen, sondern das Beherrschen des sog. juristischen Handwerkskoffers.
IV. Anspruch C gegen A aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB
Nun kommen wir aber wieder zum eigentlichen Ausgangsfall der Trier Weinversteigerung. In unserem vereinfachten Fall ist der Versteigerer auch gleichzeitig der Eigentümer des Weines. Wir prüfen daher wie folgt im Anspruchsaufbau:
1. Anspruch entstanden
C könnte gegen A einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 500 EUR und Abnahme des Weines aus § 433 Abs. 2 BGB haben.
Dies setzt voraus, dass die Parteien einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen haben. Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme i.S.d. §§ 145 ff. BGB, zustande.
Vorliegend könnte ein Kaufvertrag gem. § 433 BGB zwischen A und C gem. § 156 BGB durch ein Gebot des A (= Angebot) und den Zuschlag des Auktionators C (= Annahme) zustande gekommen sein.
a) Angebot des A
A müsste also auf der Wein-Auktion ein Angebot abgegeben haben. Fraglich ist somit, ob A eine Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Kaufvertrages gem. § 433 BGB über den Wein gerichtet war, abgegeben hat.
Dies könnte er getan haben, indem er seinem Freund F mit dem Arm zugewunken hat. Mithin müsste es sich beim Armheben und Zuwinken um eine Willenserklärung handeln. Eine Willenserklärung ist eine auf die Erzielung einer privatrechtlichen Rechtsfolge gerichtete Willensäußerung. Der Tatbestand einer Willenserklärung besteht aus einem subjektiven (inneren) sowie einem objektiven (äußeren) Erklärungstatbestand.
aa) Objektiver Erklärungstatbestand
Der objektive Erklärungstatbestand ist gegeben, wenn sich das Verhalten des A für einen objektiven Beobachter als Äußerung eines Rechtsfolgewillens darstellt (sog. Rechtsbindungswille). Ein objektiver Beobachter der Wein-Aktion musste davon ausgehen, dass A mit dem Heben seiner Hand eine Erklärung abgeben wollte, und zwar in Form eines Gebots. Mithin liegt der objektive Erklärungstatbestand vor.
bb) Subjektiver Erklärungstatbestand
Fraglich ist indes, ob auch der subjektive Erklärungstatbestand erfüllt ist. Dieser besteht aus 3 Bestandteilen:
- Handlungswille
- Erklärungsbewusstsein
- Geschäftswille
Hinweis: Der Handlungswille ist stets notwendig, während es auf den Geschäftswillen, d.h. den Willen, das konkrete Geschäft abzuschließen, nicht ankommt. Der Geschäftswille ist keine zwingende Voraussetzung einer wirksamen Willenserklärung. Welche Anforderungen an das Erklärungsbewusstsein zu stellen sind, ist umstritten.
(1) Handlungswille
Fraglich ist, ob A Handlungswille hatte. Das ist der Wille, überhaupt eine Handlung vorzunehmen. A hat hier dem Freund willentlich und bewusst gewunken. Handlungswille liegt vor.
(2) Erklärungsbewusstsein
Fraglich ist indes, ob A auch mit Erklärungsbewusstsein handelte. Die zwei Haupttheorien, die in diesem Kontext diskutiert werden, sind:
Willenstheorie:
Diese Theorie betont die Bedeutung des tatsächlichen Willens des Erklärenden. Sie geht davon aus, dass eine Willenserklärung nur dann wirksam ist, wenn der Erklärende sich des rechtlichen Charakters seiner Handlung bewusst ist.
Nach dieser Theorie wäre A’s Handlung im Weinversteigerungsfall als nichtig angesehen worden, da ihm das Erklärungsbewusstsein fehlte. Die Willenstheorie sieht das Erklärungsbewusstsein als notwendigen Bestandteil einer Willenserklärung an.
Erklärungstheorie:
Im Gegensatz dazu basiert die Erklärungstheorie auf dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und argumentiert, dass eine Willenserklärung auch dann wirksam sein kann, wenn der Erklärende nur potenzielles Erklärungsbewusstsein besitzt.
Das bedeutet, der Erklärende hätte bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten als Willenserklärung aufgefasst wird.
Diese Theorie wurde im Fall der Trierer Weinversteigerung angewendet, und es wurde festgestellt, dass A’s Handlung als wirksame Willenserklärung anzusehen ist, obwohl ihm das aktuelle Erklärungsbewusstsein fehlte. Er hätte bei Anwendung der im Rechtsverkehr erforderlichen Sorgfalt ohne Weiteres erkennen können, dass das Heben der Hand auf einer Versteigerung als Willenserklärung aufgefasst wird.
Stellungnahme
Die Erklärungstheorie berücksichtigt in besonderem Maße das Prinzip des Vertrauensschutzes. Sie erkennt jedoch auch Ausnahmen an, wenn der Empfänger der Erklärung nicht schutzwürdig ist.
Ist ein Rechtsgeschäft ohne Erklärungsbewusstsein zustande gekommen, kann der Erklärende (hier A) – sofern es zu seinem Vorteil ist – entscheiden, ob er den Vertrag bestehen lässt oder anfechtet. Diese Wahlmöglichkeit bietet die Willenstheorie hingegen nicht.
Mithin ist der Erklärungstheorie zu folgen.
(3) Zwischenergebnis
A handelte mit potenziellem Erklärungsbewusstsein. Damit ist der subjektive Tatbestand der Willenserklärung erfüllt. A hat ein wirksames Angebot abgegeben.
b) Annahme durch C
Dieses Angebot hat C angenommen.
2. Anspruch nicht erlöschen (= rechtsvernichtende Einwendungen)
Im vorliegenden Fall sind Erlöschensgründe nicht ersichtlich.
3. Anspruch durchsetzbar (= rechtshemmende Einreden)
Auch rechtshemmende Einreden (z.B. Verjährung) sind hier nicht ersichtlich.
4. Ergebnis
C hat gegen A einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 500 EUR und Abnahme des Weines aus § 433 Abs. 2 BGB.
V. Fazit zum Erklärungsbewusstsein
Ein so alter Fall wie die Trierer Weinversteigerung bleibt auch heutzutage noch aktuell. Abgewandelt wurde diese Konstellation schon unzählige Male im ersten Staatsexamen abgeprüft.
Häufig wird der Fall dann mit der Anfechtung kombiniert: A kann seine Willenserklärung anfechten (§ 119 I Alt. 2 BGB). § 119 I Alt. 2 BGB, auch bekannt als Erklärungsirrtum, besagt, dass eine Willenserklärung anfechtbar ist, wenn der Erklärende bei deren Abgabe nicht den Willen hatte, diese Erklärung abzugeben. Dies bedeutet, dass der Erklärende sich nicht bewusst war, dass sein Verhalten als eine rechtsgeschäftliche Handlung (z.B. Vertragsangebot) interpretiert werden könnte. Dies war vorliegend der Fall. A wollte keine Willenserklärung abgeben, sondern seinem Freund winken. Allerdings müsste er nach der Anfechtung den Vertrauensschaden gem. § 122 I BGB ersetzen, falls Dritte Nachteile erlitten haben.
Wenn Du Hilfe benötigst, sind wir gerne für Dich da! Unsere Dozenten zeigen Dir sehr gerne den Weg auf, das Jurastudium von Anfang an richtig in Angriff zu nehmen.
Nimm gerne Kontakt mit uns auf!
RA Mario Kraatz
Gründer und Geschäftsführer der Kraatz Group
VI. FAQ zur Trierer Weinversteigerung
1. Warum ist entscheidend, ob A „Erklärungsbewusstsein“ hatte oder nicht?
Für eine wirksame Willenserklärung braucht es neben dem äußeren Verhalten auch ein inneres Bewusstsein, rechtlich erheblich zu handeln. A hat tatsächlich nicht bewusst geboten, sondern nur gewinkt. Er wollte also nichts Rechtserhebliches erklären. Die Frage ist dann, ob dieses fehlende Bewusstsein den Vertrag unwirksam macht. Das ist nach der h.M. nicht der Fall. Mithin ist der Vertrag wirksam.
2. Was ist das „potenzielle Erklärungsbewusstsein“?
Nach der herrschenden Meinung reicht es aus, dass A hätte erkennen können, dass sein Winken als Gebot verstanden wird. Es zählt also das objektiv erkennbare Verhalten, nicht sein innerer Wille – das nennt man potenzielles Erklärungsbewusstsein.
3. Ist der Vertrag damit wirksam – und kann A sich später noch dagegen wehren?
Ja, der Vertrag kommt zustande, weil das objektive Verhalten von A wie ein Gebot wirkte. A kann aber anfechten (§§ 119 ff. BGB; hier: § 119 I BGB), weil er keine rechtserhebliche Erklärung abgeben wollte. Allerdings muss er nach der Anfechtung den Vertrauensschaden gem. § 122 I BGB ersetzen, wenn Dritte Nachteile erlitten haben.
Auch interessant:
Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.




